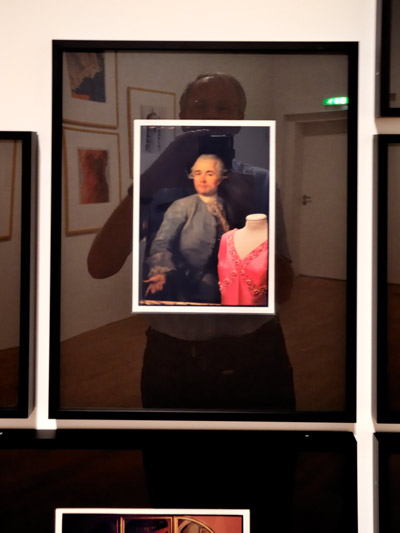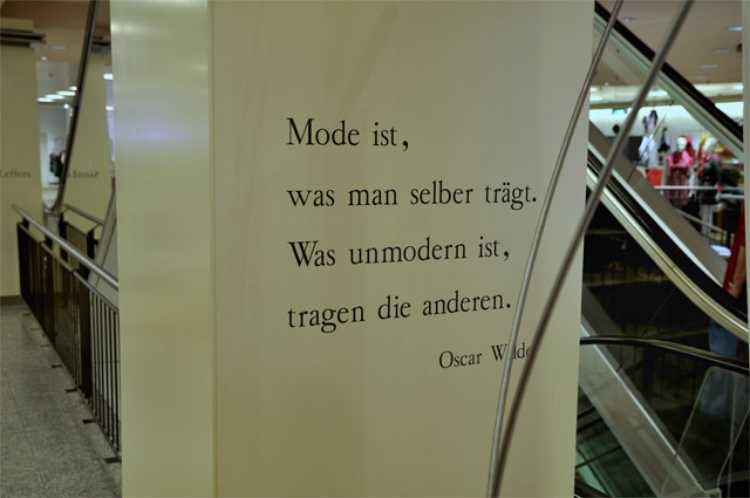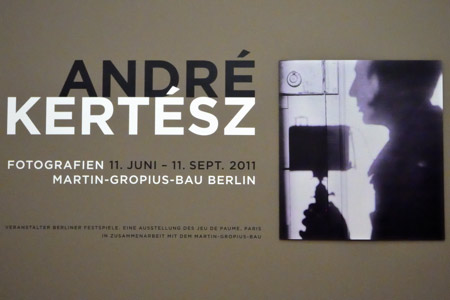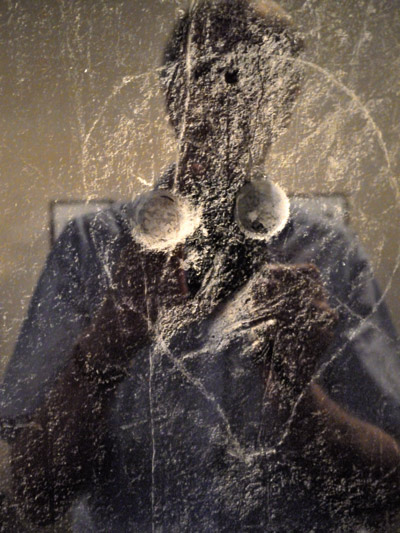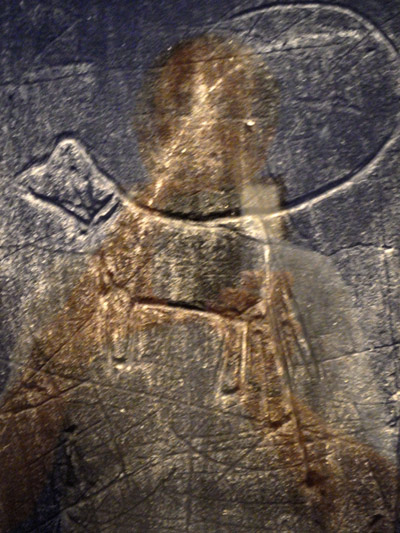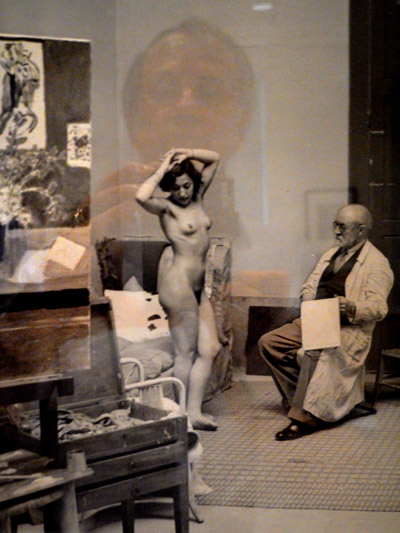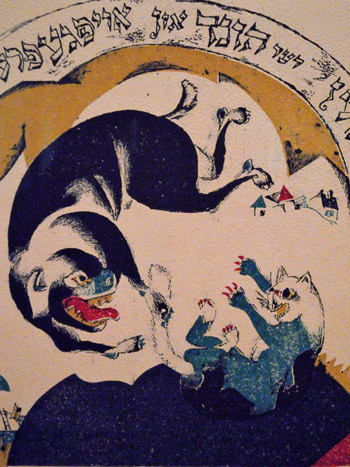Entwicklung der Stadtfotografie anhand des Fotopreises Schöneberg
Die Voraussetzung für das Begreifen der Welt besteht im Erfassen und Miterleben des Nächstliegenden. Die Welt ist auch nur ein Konglomerat aus Provinzen.

Dieses Zitat von Janos Frecot im Katalog zur Ausstellung drückt das Konzept des Fotopreises Schöneberg-Tempelhof aus – subjektive Stadtgeschichte. Den Preis gibt es seit 1990 und zur ersten Jury gehörte Janos Frecot, der die Fotoabteilung der Berlinischen Galerie aufgebaut hat. Im Haus am Kleistpark nun beginnt die Ausstellung mit einer „Collage“ aus den preisgekrönten Arbeiten aller 22 beteiligten Künstler. Dann aber fällt die Ausstellung für mich in zwei Teile:
Da sind zum einen die eher langweiligen, kleinformatigen, farbigen Fotos, die wenig Feeling aufweisen. Ihnen fehlt das Unsagbare, das ein Kunstwerk ausdrücken muss, damit es über Kunsthandwerk hinausgeht oder wie Susan Sontag sagt Das wirksamste Element im Kunstwerk ist nicht selten das Schweigen. Diese Bilder sind eher lieblos angebracht, weisen kein Passepartout auf und sind ohne Rahmen gehängt: C-Print auf Kappa, Inkjet-Prints auf Forex, C-Print auf Plexiglas und dergleichen mehr.
Zum anderen sehen wir Werke mit ordentlichem Passepartout und Rahmen und vor allem auf Barytpapier und als C-Print. Man erkennt sofort, dass die Künstler ihre Werke schätzen und der Zuschauer sie wohlwollend genießen soll. Beispielhaft möchte ich einige Namen nennen:
Ute und Bernd Eickemeyer mit ihren Porträts von Bewohnern des Crelle-Kiezes Gesichter einer Straße – Der Crelle-Kiez im Wandel, 1984-1987. Eickemeyers orientieren sich an historischen Vorbildern, wie sie August Sander in den 1920er Jahren schuf. Karl-Ludwig Lange zeigt die Serie Gasometer, Berlin Schöneberg, 1980-1981. Seine Bilder weisen mal mehr und mal weniger ihre eigene melancholische Ästhetik auf (auch: Von den Brücken – Ein großer, ästhetischer Genuss). Die hervorragend von Lange abgezogenen Baryt-Prints tun ein Übriges, wie die der anderen Künstler auch, und bis auf Thomas Leuner sind übrigens alle Werke in Schwarz-Weiß. Weiter nenne ich die Arbeiten von André Kirchner Peripherie und Mitte, 2006, Winfried Mateykas Briefe von Unbekannten„, 1993, zum Thema Graffiti und Thomas Leuner mit Der 148er aus dem Jahr 1992.
Allein für die letztgenannten Künstler und ihre Werke lohnt sich unbedingt noch der Besuch in der Ausstellung, denn sie ist nur noch bis 7. August 2011 geöffnet. Mehr zum Hintergrund der Ausstellung und zu den beteiligten Künstlern im Artikel zur Ausstellungseröffnung BERLIN, Blicke“ vom 29.05.2001. Mit der Ausstellung Berlin, Blicke im Haus am Kleistpark verabschiedet sich, nach fast 30 Jahren, Katharina Kaiser als Leiterin des Kunstamtes. www.hausamkleistpark-berlin.de