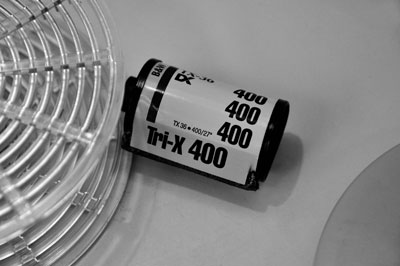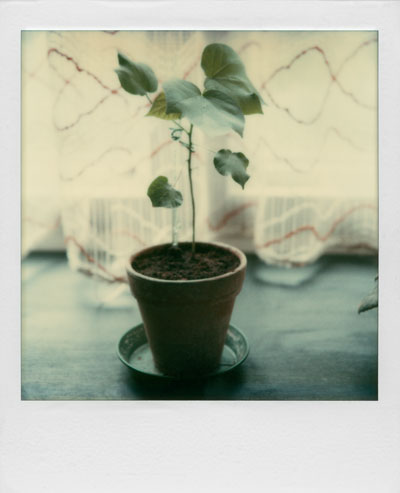Der Martin-Gropius-Bau Berlin zeigt die Werke des Life- und Magnum-Fotografen bis zum 27.November 2011
W. Eugene Smith, geboren 1918 in Wichita / Kansas und gestorben 1978 in Tucson / Arizona, hat sich seit den 1940er Jahren als politisch und sozial engagierter Fotojournalist in den USA einen Namen gemacht. Viele seiner Bildreportagen sind bei Life erschienen, dem wichtigen Magazin für Fotojournalismus, das 1936 in New York gegründet wurde. Smith sah in der Fotografie mehr als nur die Illustration zu einem Text und hat oft bei den Redakteuren mehr Mitsprache beim Gestalten eines Fotoessays eingefordert. Seinen beruflichen Einstieg fand er 1937 als Fotoreporter bei Newsweek.
1944 wurde er bei Life als Kriegskorrespondent angestellt und hielt die Schlacht von Saipan und die Landungen der Amerikaner auf den Inseln Iwojima und Okinawa fest. Im Zuge der Kämpfe veränderte sich der Stil seiner Aufnahmen: Statt enthusiastischer Darstellungen zeigte er das immense Leid der Zivilbevölkerung und entwickelte eine Bildperspektive, die den Betrachter emotional einbezog. Smith wurde am 22. Mai 1945 selbst schwer verletzt und musste bis 1947 mehrere Operationen über sich ergehen lassen.

Den symbolischen Neubeginn verkörperte für ihn das erste Foto nach seiner Verwundung. A Walk to Paradise Garden zeigt seine beiden jüngeren Kinder beim Betreten einer sonnendurchfluteten Lichtung. »Während ich meinen Kindern ins Unterholz und zu der Gruppe höherer Bäume folgte – wie sie sich an jeder ihrer kleinen Entdeckungen erfreuen konnten! – und sie betrachtete, wusste ich auf einmal, dass ich trotz alledem, trotz aller Kriege und aller Niederlagen an diesem Tag, in diesem Augenblick ein Sonett auf das Leben und auf den Mut, es weiterzuleben, anstimmen wollte.« (1954)
Nach seiner Genesung arbeitete er erneut für Life. Besonders Dokumentationen, die das engagierte Wirken einfacher Menschen zeigten, beeindruckten die Leser. In The Country Doctor (erschienen 1948) begleitete er mehrere Wochen einen jungen Landarzt aus der Nähe von Denver bei seiner Arbeit. Sein Beitrag Nurse Midwife (erschienen 1951) über die schwarze Hebamme Maud Callen entstand vor dem Hintergrund von Rassendiskriminierung und des aktiven Wirkens des Ku-Klux-Klans im Süden der USA.
Mit der Reportage Spanish Village (erschienen 1951) hatte Smith mehr Erfolg. Er wollte einen Eindruck von den Lebensverhältnissen in einem faschistischen Regime vermitteln. Nach Erhalt der nötigen Fotoerlaubnis recherchierte er zwei Monate vor Ort und wählte ein abgeschiedenes Dorf in der Extremadura für die Aufnahmen aus. Etliche der Fotografien erinnern mit ihrem strengen Helldunkel und ihrer klar gebauten Komposition an malerische Vorbilder und vermitteln mittels dieser Stilisierung ein Gefühl für die Schwere und auch die Schönheit des dortigen Lebens.
Smiths Beitrag über Albert Schweitzers Wirken in Lambaréné sollte der letzte für Life werden: Die fehlende Mitsprache bei Bildauswahl und Layout waren für ihn nicht mehr hinnehmbar und er verließ die Zeitschrift nach Erscheinen des Essays A Man of Mercy im November 1955. Eine berufliche Alternative bot die Mitgliedschaft bei Magnum, der 1947 gegründeten Agentur für Fotografen. Im Auftrag von Stefan Lorant begann Smith eine umfassende Reportage über die Stadt Pittsburgh und ihre Eisenhütten, die ihn die nächsten Jahre beschäftigte und an seine finanziellen und persönlichen Grenzen brachte.
1971 widmete er sich mit der erschütternden Serie über die Minamata-Krankheit der forcierten Modernisierung Japans und ihren schwerwiegenden Folgen. Grund für die Erkrankungen war die vom Chemiekonzern Chisso verursachte Umweltverschmutzung: Der Konzern hatte quecksilberhaltiges Abwasser in der Nähe der Stadt Minamata ins Meer geleitet. Das Komitee zur Verteidigung der Opfer beauftragte Smith, die humane und ökologische Katastrophe zu dokumentieren und der Fotograf, der sich persönlich sehr für dieses Projekt engagierte, zog mit seiner zweiten Frau, Aileen Mioko Smith, nach Minamata. Mit seinen Bildern, die bei Life und in seinem Buch A Warning to the World … Minamata veröffentlicht wurden, trug er wesentlich zur Publikmachung und Aufklärung des Falles bei.
Smith fotografisches Werk wurde mit Beginn der 1970er Jahre zunehmend museal gewürdigt. Sein Foto A Walk to Paradise Garden hatte Edward Steichen für die Ausstellung The Family of Man (1955) als symbolgebendes Schlussbild gewählt, doch erst 1971 fand die erste Retrospektive Let Truth Be the Prejudice im Jewish Museum in New York statt. 1977 zog der schwer kranke Smith nach Tucson / Ariziona und übernahm an der dortigen Universität im letzten Lebensjahr eine Lehrtätigkeit. [Quelle: Presseinformation] www.martin-gropius-bau.de